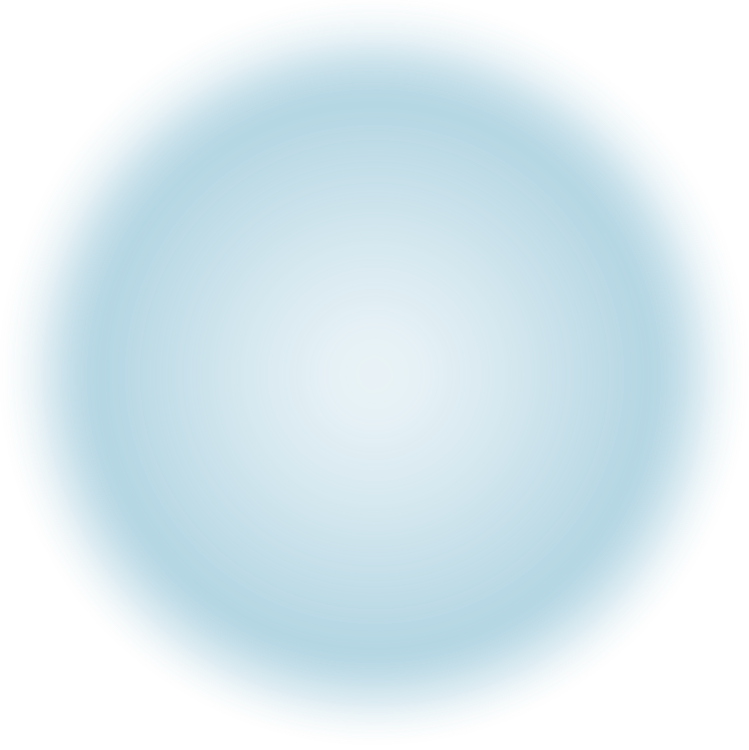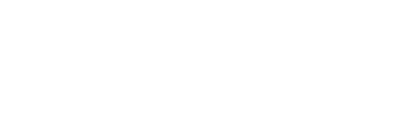Eine Imbissbude deutscher Geschichte
Am 24. Mai 2025 feiert das Stück „no shame in hope (eine Jogginghose ist ja kein Schicksal)“ von Svealena Kutschke Premiere am ITZ. Das künstlerische Team rund um Regisseurin Annika Schäfer und Ausstatter Robert Sievert gräbt sich dafür tief in die deutsche NS-Vergangenheit, verflochten mit aktuellen Diskursen über psychische Verwundungen. Bei all der Komplexität schaffen sie einen Raum, Figuren und Bilder, die skurril, witzig und scharfsinnig sind. Dramaturgin Corinna Huber sprach mit den beiden über eine Bühne als Imbissbude, ein Reh als Projektionsfläche und einen Chor als Ergebnis von Gruppentherapie.

Worum geht es in „no shame in hope“?
Annika Schäfer (AS): Um drei Frauen, die sechs Wochen gemeinsam in einer Klinik verbracht haben. Gruppentherapie! Nun, frisch entlassen, stranden sie in einem Imbiss, bevor es zurück in die eigene Realität geht. Hier werden sie mit einer Imbissverkäuferin konfrontiert, die einen ganz speziellen Auftrag zu haben scheint. Während sich die drei Frauen nun durch die Erfahrungen der letzten Wochen in der Klinik, Politik und Beobachtungen zu Körpern und ihrer Vergänglichkeit wühlen, bricht die Geschichte über sie herein: Der nicht genügend aufgearbeitete Nationalsozialismus in Deutschland. Eine Arbeit, die nun nach der Arbeit mit den eigenen psychischen Erkrankungen auf den Tisch kommen muss. Die eigene familiäre Vergangenheit, die Privatnazis – die erstmal aufgeräumt werden müssen.
Was ist das Besondere an diesem Stück?
AS: Das Besondere ist das Changieren zwischen Wahrheiten. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Hinweise lösen sich im nächsten Moment wieder auf, die Thesen, die in den Raum gestellt werden, sind wichtiger als eine stringente Geschichte. Es gibt Risse, die im Imbiss und in den Dialogen angelegt sind, wo Unerwartetes aufbricht. Das gibt uns die Freiheit, Bilder ins Verhältnis zu den Thesen der Figuren zu setzen. Es ist ein assoziativer Textraum, der ähnlich einer Traumlogik funktioniert. In dem Moment, wo wir denken, etwas verstanden zu haben, entwischt uns das Bild, der Satz, die Wahrheit.
Robert Sievert (RS): Dabei geht es immer auch um Körper, Liebe, Politik, Nostalgie und Faschismus, alles wird jeweils in Bezug zueinander gesetzt. Besonders finde ich, dass es keine Katharsis gibt. Man wird am Ende nicht erlöst. Das klingt vielleicht erst mal anstrengend, ist aber in diesem Fall sehr lustig.
Der Ort der Handlung ist ein Imbiss. Man denkt an Pommes, Bratwürstchen und Frittierfett. Was für einen Bühnenraum erwartet uns?
RS: Wir haben uns entscheiden, zuerst den Theaterraum, der üblicherweise mit Vorhängen ausgehängt ist, zurückzubauen und die verschiedenen Schichten des Raums freizulegen. Der Löwen war vorher ein Kino, davor ein Versammlungsraum der Arbeiter*innenbewegung und ursprünglich Gaststätte und Brauerei. Mit dieser Sichtbarmachung der Geschichte und in diesem stimmungsvollen Raum braucht es für einen Imbiss dann nur noch wenige Elemente wie ein paar Senfflaschen und Neonlicht.
Welche Rolle spielen die Erfahrungen der drei Frauen mit persönlichen Wunden und Schmerz im Imbiss?
AS: Die Erfahrungen spielen gerade am Anfang des Stücks eine größere Rolle, weil das die Themen sind, die die Frauen mitbringen. Sie haben auch einen gemeinsamen Sprachkörper entwickelt, der als Chor auftaucht, immer wieder von ihnen Besitz ergreift und sich im Laufe des Stücks verselbstständigt. Sie teilen die Erfahrung, sich gemeinsam sechs Wochen mit Schmerz und Wunden konfrontiert zu haben. Und nun hängen die drei in diesem Imbiss, einem Zwischenraum von Klinik und persönlichem Alltag, fest. Nachdem sie alle persönlichen Wunden intensiv bearbeitet haben, liegt der Weg frei, auf die Vergangenheit zu schauen. Welche Wunden, welcher Schmerz, welche Traumata haben die Großeltern den drei Frauen mitgegeben? Hier geht es darum in die Biografien zu schauen, die Geschichte totgeschwiegen haben. Denn es ist ein Großteil aller Deutschen, die ihre Geschichte entweder nicht kennen oder die Augen verschließen vor der eigenen familiären Nazivergangenheit.
Neben den drei Frauen gibt es noch eine Imbissverkäuferin und ein Reh. Was sind das für Figuren, die Svealena da entworfen hat und wie geht ihr damit spielerisch und im Kostümbild um?
AS: Die Imbissverkäuferin und das Reh stehen von Anfang an in einem ungeklärten Verhältnis. Es gibt eine Verbindung, die sich lange Zeit nicht erklären lässt. Reh ist eine Figur, die ständig Zuschreibungen von den anderen Figuren erfährt. Über ihn wird gesagt, dass er ein Nazi sei, wir wissen es aber nicht. Und so muss er auf der Bühne herhalten für die anderen Spieler*innen, um Thesen zu unterstreichen oder eine bildliche Übersetzung zu finden. Er kommt nur zu Wort, wenn er telefoniert. Die Imbissverkäuferin hat die Kontrolle über den Ort, sie baut den Imbiss auf, hat aber auch Phasen, in denen sie mit den Frauen auf gleicher Ebene agiert und argumentiert, trotzdem scheint sie mehr zu wissen. Sie kann als eine Art Strippenzieherin betrachtet werden. Auch wenn diese beiden Figuren einen besonderen Stellenwert in der Inszenierung einnehmen, haben wir eine gemeinsame Spielweise aller fünf Figuren gefunden. Es sind keine psychologischen Figuren mit Vorgeschichten, sondern Figuren, die sich bewusst sind, dass sie sich in einem Theaterraum mit Publikum befinden.
RS: Mich interessieren dabei die Gedanken, die auf der Bühne durch die Spieler*innen gehen. Das Kostümbild ist Material für diese Gedankenspiele. Es dient nicht zur Figurenentwicklung. Wir greifen Bilder aus dem Stück auf, setzen sie in neue Kontexte und fügen neue Bilder hinzu. Das Reh – oder der Nazi – ist als Projektionsfläche geschrieben. Eine Projektionsfläche, die mit uns flirtet. Jede*r sieht dieses Bild durch eine andere Brille.
Welcher Satz aus dem Stück hat sich in dir eingebrannt?
AS: „Ich will dann hinter so einem Huhn herrennen und es erlegen. Also es einfach müde laufen, bis wir so nebeneinander liegen und dann bin ich zu erschöpft, es zu braten, ich beiße ihm dann einfach mit letzter Kraft den Hals durch.“
RS: „Eine Discokugel!“